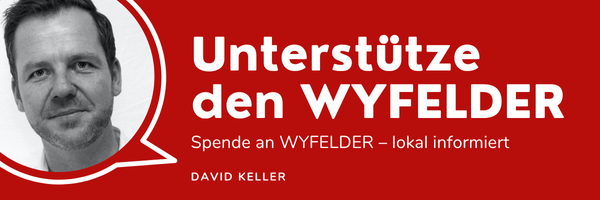Das Hungertuch bekam im Laufe der Geschichte verschiedene Namen, velum templi, also Tempelvorhang, so hiess es im Mittelalter. Im östlichen Alpenraum und damit vor allem in Kärnten kennt man die Hungertücher unter dem Namen «Fastentücher». In Tirol findet man gelegentlich die Bezeichnung «Leidenstücher». Im niederdeutschen Sprachgebrauch haben sie die Bezeichnung «S[ch]machtlappen». In der Schweiz, in Schwaben und im Elsass, aber auch in Westfalen und in Sachsen werden sie «Hungertücher» genannt. Weil die Fastenzeit offensichtlich für viele auch ein echtes Hungern bedeutete – vielleicht gingen in dieser Zeit die aufbewahrten Reserven vom Herbst zu Ende – gibt es den Ausdruck bis heute: am Hungertuch nagen. Diese verschiedenen Namen weisen auch auf verschiedene Bedeutungen des alten Fastentuch-Brauches in der Geschichte hin:
Die Verhüllung des Chorraumes – des Tabernakels
Die Altarverhüllung durch ein «velum templi» gehörte zum mittelalterlichen Brauchtum in der Fastenzeit. Der Theologe Wilhelm Durandus von Mende (+ 1296) bezeugte schon im 13. Jhd.:
«Das Tuch, welches in der Fastenzeit vor dem Altar aufgehängt wird, versinnbildet den Vorhang, der die Bundeslade verhüllte und beim Leiden des Herrn zerriss; nach diesem Vorbild werden heute noch Tücher von mannigfacher Schönheit gewoben.»
Die deutsche Künstlerin Konstanze Trommer hat das aktuelle Hungertuch gestaltet.
Am Aschermittwoch wurde es aufgehängt und bleibt als sichtbares Zeichen bis zum Gründonnerstag.
Es trägt den Namen: Damit alle eine Zukunft haben.

Der Titel greift die Tatsache auf, dass viele Menschen auf der Welt Hunger leiden. Und Hunger frisst Zukunft auf.
Hier ein Hoffnungszeichen zu setzen, ist unser kirchliches Anliegen.
Im Pastoralraum bieten wir am 12. / 19. / 26. März in der kath. Kirche in Sulgen Meditationen zum Hungertuch an. Beginn ist jeweils um 18.30 Uhr.
zVg