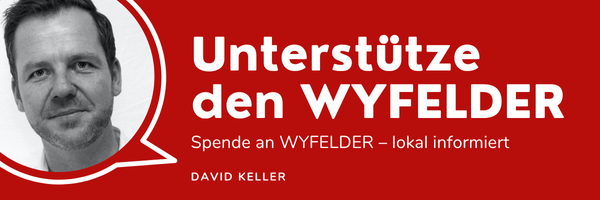10. April 2025
Seit zwei Jahren läuft ein Geothermie-Forschungsprojekt des Kantons Thurgau mit Unterstützung des Bundesamtes für Energie in Schlattingen. Aus zwei bestehenden Tiefenbohrungen sollen zusätzliche Erkenntnisse über den Thurgauer Untergrund gewonnen werden. Damit können wichtige Grundlagen zur Wärmegewinnung im Kanton geschaffen und die Erfolgschancen zukünftiger Projekte erhöht werden. An der heutigen Medienkonferenz vor Ort wurden die ersten Zwischenergebnisse vorgestellt.
Die Erdkruste ist eine riesige und unerschöpfliche Energiequelle. Mit der Tiefe nimmt die Temperatur zu, im Schnitt um drei Grad pro hundert Meter. Man spricht in diesem Zusammenhang von Geothermie. Je nach Temperaturniveau kann diese Wärme zum Heizen oder für die Stromproduktion verwendet werden. Seit 2022 nutzt die Grob Gemüse AG in Schlattingen die Wärme aus dem Untergrund für das Beheizen ihrer Gewächshäuser. Die Wärme wird über zwei Bohrlöcher (Bohrung 1 und 2) aus einer Tiefe von rund 1’200 Metern entzogen. Dabei wird eine wasserführende Gesteinsschicht (Aquifer), der sogenannte Muschelkalk, angezapft. Der Muschelkalk entstand aus Ablagerungen des flachen Meeres, das vor rund 240 Millionen Jahren das heutige Mitteleuropa bedeckte. Aus diesem Aquifer wird das Wasser mit einer Temperatur von rund 64 Grad Celsius an die Oberfläche gepumpt. Über einen Wärmetauscher erfolgt die Wärmeabgabe an die Treibhäuser des Gemüsebetriebs. Damit werden rund eine halbe Million Liter Heizöl pro Jahr eingespart, was zu einer Reduktion von etwa 1’500 Tonnen CO2-Emissionen führt.
Unterschiedliche Herkunft des Wassers
Die Bohrungen in Schlattingen ermöglichen nicht nur die CO2-freie Produktion von Gemüse, sondern bieten auch die Möglichkeit, Einblicke in den Untergrund zu gewinnen, was wertvolle Erkenntnisse für zukünftige ähnliche Projekte liefert. Der Kanton Thurgau reichte deshalb 2022 ein Forschungsprojekt beim Bundesamt für Energie (BFE) ein. «Ziel ist es, die Funktionsweise dieses Geothermiereservoirs zu verstehen und so die Erfolgschancen für die zukünftige Nutzung der Geothermie zu erhöhen», wie Philippe Müller, Sektionsleiter Energieforschung und Cleantech beim BFE, betonte. Das BFE und der Kanton Thurgau teilen sich die Kosten. Die Grob Gemüse AG ihrerseits stellt die Bohrlöcher zu wissenschaftlichen Zwecken zur Verfügung. Die Forschungsarbeiten unter der Leitung der Universität Bern starteten Anfang 2023 mit der Entnahme von Wasserproben.
Die umfassenden Analysen zeigen, dass das Wasser aus den beiden Bohrlöchern eine unterschiedliche Herkunft aufweist. Bohrung 1 wurde senkrecht ausgeführt, Bohrung 2 abgelenkt, so dass sich die Fassungen rund einen Kilometer voneinander entfernt befinden. Das Wasser aus der senkrechten Bohrung stammt aus Niederschlägen, die während der letzten Eiszeit in der Region des Wutachtals im Südschwarzwald niedergegangen sind. Dort kommt die wasserführende Karbonatschicht, die sich in Schlattingen in einer Tiefe von rund 1’200 Metern befindet, an die Oberfläche. Die Niederschläge konnten an dieser Stelle einsickern. Interessanterweise stammt ein bedeutender Anteil des Wassers der abgelenkten Bohrung 2 aus dem kristallinen Grundgebirge, also aus Gesteinsschichten, die sich noch tiefer befinden. Dr. Christoph Wanner, wissenschaftlicher Leiter des Projekts von der Universität Bern, erklärte, dass dies unter anderem durch erhöhte Konzentrationen von Helium und Lithium zweifelsfrei belegt werden könne.
Ähnliche Wassertemperaturen
Das Wasser aus Bohrung 2 gleicht in der chemischen Zusammensetzung dem Thermalwasser in Schinznach, Baden oder Riehen. Weil es aus tieferen Schichten stammt, würde man eigentlich eine höhere Temperatur erwarten. Der Unterschied zur Wassertemperatur aus Bohrung 1 ist jedoch nur sehr gering. Dies legt die Vermutung nahe, dass sich das Wasser auf seinem Weg zur Entnahmestelle abgekühlt haben muss. Das bedeutet, dass der Ort des Wasseraufstiegs aus dem kristallinen Grundgebirge weit von der Wasserfassung der Bohrung 2 entfernt ist oder das Wasser nur langsam aufsteigt. Solche Wasseraufstiege aus dem Grundgebirge erfolgen entlang von Störungszonen, das heisst in Rissen und Spalten. In der Nähe der Bohrungen befindet sich eine solche Störungszone, die «Randen-Störung». Dort sind die Gesteinsschichten aufgrund von Kräften im Erdinnern verschoben oder versetzt worden. Je näher eine Bohrung an störungsgebundenen Wasseraufstiegszonen ist, desto höher müsste die Wassertemperatur sein. «Störungszonen sind daher für diese Art der Geothermienutzung, die sogenannte hydrothermale Geothermie, von besonderem Interesse», führte Dr. Christoph Wanner aus.
Nutzen für andere Projekte dank Modellierung
Die bisherigen Erkenntnisse aus dem Forschungsprojekt fliessen in zwei Modellierungen ein. Beim ersten Modell geht es um die Simulation der Grundwasserflüsse in unmittelbarer Umgebung der beiden Bohrungen. Beim zweiten Modell werden zusätzlich Bruchnetzwerke in der Nähe von Störungszonen berücksichtigt, um den Aufstieg von Grundwasser aus dem kristallinen Grundgebirge besser zu verstehen. Die Modelle ermöglichen ein klareres Bild über die wasserführenden Gesteinsschichten für das Gebiet rund um Schlattingen, sind aber auch für den Kanton Thurgau wertvoll. Im Herbst 2025 wird das Forschungsprojekt abgeschlossen. Die neuen Erkenntnisse über den Untergrund erleichtern Entscheide, weitere geeignete Standorte zur Nutzung der Erdwärme zu eruieren, und erhöhen damit die Erfolgschancen zukünftiger geothermischer Projekte im Kanton.
Auch das Projekt TEnU 2030 profitiert
«Das Wissen aus Schlattingen fliesst auch in das Projekt TEnU 2030 der Geothermie Thurgau AG ein», hob Dr. Bernd Frieg hervor. Er leitet das Projekt «Thurgauer Energienutzung aus dem Untergrund», das im letzten Jahr gestartet ist, und bildet auch das Bindeglied zum Forschungsprojekt in Schlattingen. Der Fokus bei TEnU 2030 liegt auf dem gesamten Kanton Thurgau und auf zusätzlichen Anwendungen wie Wärmespeicher oder Speicherung und Abscheidung von CO2. Das Projekt profitiert von Geldern aus dem Thurgauer Chancenpaket, das von der Thurgauer Stimmbevölkerung 2023 angenommen wurde, sowie von Fördergeldern des Bundes.
Hinweis:
Zur spannenden Geschichte der Geothermiebohrung und -nutzung in Schlattingen wurde eine Filmserie erstellt. Mit dem 7. Modulfilm wurde die Serie abgeschlossen. Die Filme finden Sie unter: www.energie.tg.ch.
DIV_Forschungsprojekt_Geothermie_Schlattingen_Präsentation_Wanner [pdf, 6.1 MB]
DIV_Forschungsprojekt_Geothermie_Schlattingen_Präsentation_Müller [pdf, 158 KB]
DIV_Forschungsprojekt_Geothermie_Schlattingen_Präsentation_Frieg [pdf, 437 KB]
tg.ch