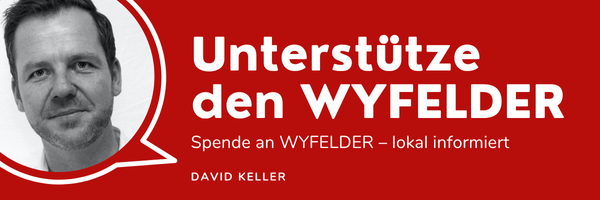«Fundstücke aus der Weinfelder Geschichte und Kultur» - Nr. 4
Bild oben: Ein eingelassener Stein in den alten Grundmauern des «Stelzenhofes» gibt Rätsel auf. Bestimmt um einiges älter als der historische Bau des Hofes aus dem 17. Jahrhundert. – Foto: M. Mente
Steine wandern und können eine Geschichte erzählen: Ein Fundstück auf dem «Stelzenhof» gibt Rätsel auf bei einem Augenschein vor dem Verkauf des alten Hofes gegenüber der Wirtschaft. Und wenn wir schon mal da sind, wo liegt eigentlich der «Stelzenhof» wirklich?
Michael Mente
«Das ist der richtige Stelzenhof», sagt Heinz Junker und man merkt ihm einen gewissen Stolz und sogar etwas Schalk an. Er und noch zwei Geschwister sind die letzten einer 13-köpfigen Kinderschar, die auf dem alten Hof an der Stelzenhofstrasse Nr. 12 aufgewachsen sind. Sein Vater hat das Gut 1912 erworben, zuletzt hat der Bruder noch hier gelebt. Nun steht die Liegenschaft gegenüber der heutigen «Wirtschaft zum Stelzenhof» zum Verkauf.
Heinz Junker nimmt Abschied und erzählt auf einem Rundgang die lebhafte Familiengeschichte. Am Schluss bleibt er vor dem Eingang zum Keller stehen und zeigt, mit nicht weniger Stolz, auf einen im alten Mauerwerk eingelassenen Stein mit einem Relief-Wappen, der die Fantasie der Knaben angeregt hatte. Man hatte ihn vergessen, so überwachsen waren die Grundmauern im Lauf der Jahre.
Das ist nun anders. Im März 2021 präsentiert sich der alte Bauernhof zum ersten Mal seit Jahren gründlich aufgeräumt, befreit von viel Gestrüpp und Überwucherungen. Wovon erzählt dieser alte Zeuge aus Sandstein mit Leuenwappen?
Wo liegt der «Stelzenhof»?
Junker hat nicht ganz Unrecht, wenn er sagt, dass sein Elternhaus der eigentliche «Stelzenhof» sei. Die Besucher der «Wirtschaft zum Stelzenhof», inmitten eines der beliebtesten Naherholungsgebiete Weinfeldens, kehren seit über 100 Jahren bei Familie Kamm ein; kaum jemand aber nahm in den letzten Jahren Notiz vom zunehmend etwas verwahrlosten Gut gegenüber.
Zunächst: In der Geschichte ist tatsächlich etwas vergessen gegangen, dass es sich beim «Stelzenhof» nicht um ein Haus, sondern um einen Weiler handelt; schon im Mittelalter bestand er aus mindestens zwei Teilen, die dann zusammengeführt nach Verkäufen 1577 und 1584 an die Weinfelder Schlossbesitzer (von Gemmingen) verkauft wurden. Es gab sogar Bestrebungen, nachdem die Stadt Zürich 1644 die Herrschaft Weinfelden erworben hatte, diese Gehöfte mit denjenigen des weiter unten gelegenen «Rathof» zu vereinigen.
In den Jahren 1665/66 wurde an der Stelle des Bauernhauses, das nun im März 2021 als ziemlich renovationsbedürftig zum Verkauf steht, ein Neubau errichtet, den die Zürcher damals als «treffenlich wohl erbouwen» beurteilten. Seither sind verschiedene Umbauten erfolgt, die Grundmauern dürften aber noch vom alten Hof aus dem 17. Jahrhundert stammen. Die südlich bestehende Wirtschaft, das heutige Restaurant, wurde 1894 erbaut. Ob vorher hier schon ein Gebäude gestanden hat, lässt sich nicht beantworten, doch eines ist noch zu erwähnen: Nach Hermann Lei trug die Wirtschaft ursprünglich, aber nur für kurze Zeit, den Namen «Frohsinn».
«Ein Raubstück» aus alten Zeiten
Noch ein Grund also, zu betonen, dass Junkers den sozusagen eigentlichen «Stelzenhof» bewohnt haben.
Nicht nur der Name ist hier Gegenstand einer Übertragung – und damit zurück zum Fundstück am Bau, dem Wappenstein: Archäologen und Historiker sprechen bei so einem «Fremdkörper» von einer sogenannten «Spolie». Der Ursprung des Wortes geht auf das Lateinische Wort für «Raub», «Beute» zurück. Doch soweit muss man nicht immer gehen. Es geht im Prinzip darum, dass Bauteile und andere Überreste von Gebäuden, Ruinen usw. aus älteren Zeiten in neueren Bauwerken wiederverwendet werden.
Bis in die Vormoderne war es üblich, Baumaterialien laufend zu rezyklieren. Schliesslich waren Materialien häufig knapp, kosteten und mussten so schon einmal nicht von weit hergetragen werden. Verschiedene Burgstellen rund um Weinfelden sind gerade deshalb verschwunden; ihre Steine lebten in verschiedenen Häusern weiter.
«Wandernde Steine»
So auch in unmittelbarer Nähe zum «Stelzenhof» geschehen: Beim «Thurberg», heute ebenfalls beliebtes Ausflugsrestaurant, genauer auf dem «Guggisbärg», stand einst ein römischer Wachtturm, dessen Reste wohl für die spätere Burg am gleichen Ort verwendet worden waren. Nachdem diese Feste selbst zur Ruine geworden war, trugen um 1640/41 nach Berichten zwei Knechte während neun Tagen Steine ab und warfen sie zum Schloss hinunter, wo sie für den Bau eines Waschhauses vor der Zugbrücke verwendet wurden. 1644 wurde dann die Burg neuerlich aufgebaut, wurde aber schon ein Jahr später vom Wind zerstört. Etwas südlicher versuchten die Zollikofers aus Altenklingen mit einem Schlösschen mit zwei Türmen sodann ihr Glück, doch 1827 zerstörte ein Blitz das Gebäude nachhaltig. Damit war Schluss mit Schloss und Burgen in dieser Gegend: Um 1830 wurden alle Reste, inklusive Burghügel auf dem «Guggisbärg» abgetragen und ein Parkplatz auf der Burgstelle, das Restaurant auf der Schloss-Stelle errichtet. Wohin die Steine gingen, wer weiss…
Die gleiche Frage, wie gesagt, liesse sich für alle Burgstellen und befestigten Häuser und Orte der Gegend stellen. Nördlich des «Stelzenhofs» finden wir noch das «Schatzloch», heute gerade auf Hugelshofer/Kemmentaler Gemeindegebiet gelegen; ebenfalls Burgstelle. Weitere liessen sich nennen.
Steine – und andere Materialien – wandern also. Besondere Stücke – damit zurück zu den «Spolien» – wurden seit dem Mittelalter, insbesondere aber seit der Renaissance etwas geplanter, zu Schmuck und Zier oder als «historisches Zitat» in Gebäuden wiederverwendet.
Irgendwann setzte der Hausbesitzer des «Stelzenhofs», vielleicht waren es bereits die Erbauer im 17. Jahrhundert, den Wappenstein mit den beiden Löwen in die Grundmauer ein, gut sichtbar neben dem Kellereingang. Woher er stammt, darüber kann vorderhand nur gerätselt werden. Ein paar Ideen?
Wohin blicken die Leuen?
Auf dem Stein sichtbar ist ein Wappen, das an das Kyburger Wappen und dasjenige der Landgrafschaft Thurgau erinnert: zwei steigende Löwen, getrennt von einem schräg gestellten Balken. Ohne weiter ins Detail zu gehen: Das mittelalterliche Wappen der Landgrafschaft Thurgau und der Landvogtei leitete sich von den Kyburgern ab, die hier Städte gründeten und Herrschaftsrechte ausübten. Wie einst die Habsburger, die sich als Erben und Rechtsnachfolger der Kyburger verstanden haben, aus Legitimierungsgründen das Wappen für ihre Herrschaftsansprüche im Thurgau für die Landgrafschaft und die Landvogtei übernommen haben, so haben auch die Eidgenossen ab 1460 das Wappen weitergeführt. Schliesslich wurde Jahrhunderte später daraus das Kantonswappen abgeleitet.
Ob das Wappen bzw. der Stein am «Stelzenhof», wie Junkers rätseln, von einer Burg aus Habsburger Zeiten stammt? Das wohl eher nicht, auch wenn nicht auszuschliessen ist, dass der Stein von einer der umliegenden Burgstellen wie etwa dem «Thurberg» stammen könnte. Schliesslich standen viele Thurgauer Adelsfamilien auf unseren Burgen in habsburg-österreichischen Diensten; Weinfelder sind auch an Morgarten gefallen. Realistisch aber ist, dass es sich um einen Stein von einem repräsentativen Gebäude stammend handelt, denn es war durchaus üblich, dass man über dem Türsturz Wappen montierte.
Und das führt zur Frage, warum die Leuen, die in eine weit zurückliegende Geschichte zurückblicken, als der Thurgau ein komplizierter Herrschaftsbereich war, auf dem Wappen in die «falsche» Richtung blicken. Montierte man nämlich zwei Wappen über einem Eingang, auf einer Fassade usw., «wandte» sich das linke Wappen dem rechten zu – es wurde gespiegelt bzw. heraldisch gesprochen «gewendet». Bei sogenannten «Allianzwappen», wenn adlige und andere wichtigen Familien sich verheirateten, war das auch auf Scheiben usw. gang und gäbe. Es führt aber ins Reich der Fantasie, sich bei diesem Stein diesbezüglich weiter Gedanken darüber zu machen.
Die Vermutung liegt nahe, dass es sich beim auf dem Stein abgebildeten Wappen um das Zeichen der Landgrafschaft Thurgau, vielleicht auch des landvogteilichen Gerichts handelte. Da darf man wohl an ein wichtiges Gebäude denken, wo etwa Gericht gehalten wurde oder ein Repräsentant, ein Vogt usw., residierte. Ob die betreffende Person oder der Ort sich auf dem «Stelzenhof» selbst befunden hatte?
Naheliegend ist aber noch eine andere These, dann sind aber die Grenzen der Spekulation erreicht: Beim Stein könnte es sich auch um einen Grenzstein handeln. Doch wo könnte der gesetzt gewesen sein?
Betrachtet man sich den Thurgau bzw. den herrschaftlichen Flickenteppich aus hohen und niederen Gerichtsbarkeiten, adligen, städtischen und bürgerlichen Rechten, Verhältnisse, die bis zur Französischen Revolution gegolten haben, dann sehen wir nordöstlich von Weinfelden bzw. des «Stelzenhofes», ein Gebiet, das unter sogenannt hoher Gerichtsbarkeit stand, ein Flecken um Hugelshofen, der direkt dem Landvogt in Frauenfeld unterstand. Ob der Stein also in der unmittelbaren Gegend des «Stelzenhofs» gefunden und dann hier zur Zier eingesetzt wurde?
Die These ist allerdings auch etwas wackelig, abgesehen davon, dass man auch die Rückseite des Steines prüfen müsste: Grenzsteine zu entfernen war im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit ein schweres Vergehen und wurde mit zum Teil drakonischen Strafen belegt. Schwer denkbar also, sollte es sich nicht um einen regulären Ersatz gehandelt haben, dass man einen geraubten Stein – dann also erfüllt das Wort «Spolie» schon fast ihren Wortsinn – so augenfällig in der Fassade präsentiert.
Woher auch immer sie kommen: In welche Zukunft die Leuen blicken, ist im Frühling 2021 offen. Mit dem Verkauf der Liegenschaft – das Haus ist bei der kantonalen Denkmalpflege als «bemerkenswert» eingestuft – beginnt wieder einmal ein neuer Abschnitt in die Geschichte des «Stelzenhofs».

«Ungefarlicher Abriss des Huses auff dem Stelzenhoff» – Eine Federzeichnung aus dem Jahr 1666, das den ursprünglichen, hier gerade gebauten, «Stelzenhof» (wohl Stelzenhofstr. 12 und eben nicht die Wirtschaft) zeigt. Abb. aus H. Lei, Geschichte und Geschichten, S. 71.

Als die heutige «Wirtschaft Stelzenhof» noch «Frohsinn» hiess. – Foto: Ansichtskarte um 1915, Sammlung Martin Sax.
PS – Ein Wort zum Namen «Stelzenhof»
Es gibt zwei Möglichkeiten, darüber nachzudenken, woher der Name des kleinen Weilers kommen mag. Die einen führen es auf Personennamen zurück; so ist in einer Urkunde von 1423 ein Konrad Stelzenhofer von Weinfelden erwähnt (H. Lei). Wer kann aber entscheiden, ob er den Namen nicht zugeschrieben erhalten hat, da er eben auf dem Stelzenhof lebt? Und wenn es doch so wäre, dass es der Hof war, auf der ein Stelz, Stelzer lebte, dann wäre das ein Familienname, der aus einer Art Übername entstanden ist: einer, der auf Stelzen geht, der Stelzfuss. Genauso wahrscheinlich, da wir in Weinfelden auch den Flurnamen «Stülzen» oder «Stülzli» (unter «Sefi» gelegen) kennen, ist die Möglichkeit, den Namen auf die Geländeform zu beziehen. Der Begriff bezeichnet in etwa einen schmal auslaufenden Teil eines sonst rechteckigen Stück Ackers, Landes.

Die Liegenschaft Stelzenhofstrasse 12, der eigentliche «Stelzenhof», wie er sich im März 2021 präsentiert. – Foto: M. Mente

Die im Text besprochene Umgebung. – Karte: © Swisstopo

Detailliertere Ansicht der Umgebung mit der Burgstelle «Schatzloch» zwischen «Wachtersberg» und alter Kiesgrube. – Karte: © Swisstopo.
• Mehr zur Geschichte des Stelzenhofs: Lei, Hermann: Geschichte und Geschichten um Weinfelder Häuser und Plätze. Weinfelden 1974.
• Zum «Thurberg»: Ebd., S. 68 f.; Ders., Weinfelden. Die Geschichte eines Thurgauer Dorfes. Weinfelden, 1983, S. 29–31.

Michael Mente – ist Historiker, Archivar, Autor verschiedener Bücher und Beiträge und arbeitet derzeit in der Denkmalpflege des Kantons Thurgau. Er ist in Weinfelden aufgewachsen und schreibt für den Wyfelder seit Start. In der Reihe «Fundstücke aus der Weinfelder Geschichte und Kultur» erzählt er uns zudem in loser Reihenfolge durch «sein» Weinfelden spazierend von unserem Städtchen.