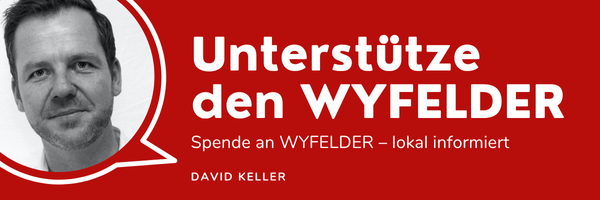«Fundstücke aus der Weinfelder Geschichte und Kultur» - Nr. 9
Ein aufmerksamer Spaziergänger, der mich von der Burg herkommend zurück Richtung Dorf begleitete, stellte kurz nach dem Einbiegen in die heute als Quartierverbindung ausgebaute Strasse die Frage nach der Herkunft des Namens «Kappelerweg». Bevor ich dazu etwas sagen konnte, rückte er sich die Kappe zurecht und fragte, ob es denn hier mal eine Kapelle gegeben habe? Die Antwort führt in frühe Zeiten der Weinfelder Geschichte.
Michael Mente
Man geht für gewöhnlich ohne viel Nachdenken nur allzu häufig an selbstverständlich gewordenen Dingen vorbei und kommt bei genauerem Hinsehen dann plötzlich ins Grübeln. Wie heisst der Weg? Káppelerweg – die Betonung ist auf dem «a», so gar nicht wie im Wort Kapelle, wo die Betonung auf dem ersten «e», sprich Kapélle, liegt. Und jenes erst noch mit nur einem «p»? Und doch, der Spaziergänger lag mit seiner Vermutung richtig: Es geht tatsächlich um eine Kapelle.
Zunächst: Einen Standort für ein ehemaliges Gotteshaus in dieser Gegend auszumachen, scheint heute nicht mehr möglich. Es gibt bisher keine Hinweise auf Funde beim Bauen von Häusern. Chronist Keller verortete die Kapelle «oberhalb» der «Sonne» (heutiges Restaurant), Hermann Lei blieb allgemeiner und sprach von einer Lage «nördlich der Abzweigungen nach Mauren und Bürglen». Eines aber ist klar: Die Kapelle, die vermutlich vor allem von den Bewohnerinnen und Bewohnern des Weilers Gontershofen zum Gottesdienst besucht worden war, dürfte einst in einer erhöhten Position, mitten in einer Reblandschaft, irgendwo zwischen heutigem Kappelerweg und dem schon im Mittelalter mit Reben bebauten «Wolperholz» gestanden haben. Das «Wolperholz», ein grösseres und altes Flurnamengebiet, endet oben am Allenbergweg, der parallel zum Kappelerweg auf der heute bewaldeten Kante verläuft. Wie die von dort oben zum Kappelerweg zum Teil steil abfallende und heute mit Wohnhäusern bebaute Flanke einst hiess, ob einst ebenfalls zum «Wolperholz» gerechnet, ist unbekannt; aber Keller erwähnt, dass die Reblage hier zu seiner Zeit «Kappeler» (oder «zum Kappeler») geheissen habe.
Zwar lässt sich der Rebbau in alten Karten tatsächlich noch länger vermuten, aber ein offizieller Name für die Reblage ist leider nicht auszumachen. Offensichtlich aber wurde der Name «Kappeler» als Bezeichnung auf diesen Weg übertragen. Wann dies geschah, weiss man nicht; ein Weg ist auf dem alten Weinfelder Zehntenplan, der im Bürgerarchiv hängt, ersichtlich, auf späteren Karten sind verschiedene Verläufe sichtbar. Ende des 19. Jahrhunderts ist er (wieder?) in einem Verlauf ersichtlich, der dem heutigen entspricht. Seit Ende der 1940er-Jahre trägt die Verbindung jedenfalls offiziell den Namen «Kappelerweg».

Der «Kappeler», das zur Kapelle gehörende oder bei der Kapelle liegende Rebgut also. Das ist in der Erinnerung geblieben. Eine Kapelle war tatsächlich vorhanden: Sie war allerdings schon im Spätmittelalter eine Ruine. Keller erwähnt zum Jahr 1436 «starke Überreste».
Das ist interessant, auch wenn Keller seine Quelle nicht nennt und das Jahr merkwürdig ist. Aber: Neben indirekten Hinweisen in anderen Quellen auf Widum-Güter – Höfe, die man zur Versorgung von Priesterstellen eingerichtet hatte – ist es immerhin der einzige konkrete Hinweis auf eine Kapelle auf dem nachmaligen Weinfelder Gemeindegebiet. Lassen wir die Kapelle im Schloss Weinfelden und die Frage, ob andere Burgstellen auch Gotteshäuser aufgewiesen haben, an dieser Stelle aussen vor: So sind aber noch mindestens zwei weitere Kapellen indirekt zu erschliessen, die aus dem frühen Mittalter gestammt haben und gegen das Spätmittelalter verschwunden sein dürften:
Eine Kapelle wird auf dem Gebiet des «Eigenhofs» vermutet, eine weitere auf dem Kirchenfelsen, denn dort wurde erst in der Mitte des 13. Jahrhunderts für die Weinfelder eine erste eigene Kirche, höchstwahrscheinlich an die Stelle einer alten Kapelle, errichtet. Und nur hier wissen wir, wem die neue Kirche geweiht wurde: St. Johannes. Gut ein Jahrhundert, nachdem in Bussnang, zu dessen Kirche die Weinfelder bisher und seit dem Frühmittelalter zugehörig waren, ebenfalls ein grösserer Neubau dem gleichen Heiligen gewidmet worden war.
Wir leben heute in Zeiten, in denen angesichts schwindender Mitgliederzahlen, neuen Bedürfnissen und finanzieller Bürden im Unterhalt teurer Liegenschaften über die Umnutzung und Aufgabe von Kirchenbauten nachgedacht werden muss; ein Abbruch ist aber oft, auch in eher kirchenferneren Kreisen, mit einem Unbehagen verbunden. Nicht so im Mittelalter, wo die Gründe für Abbrüche, Neubauten etc. natürlich andere waren als der zahlenmässige Umfang an gläubigem Volk, auch wenn dieses literarisch urkundlich immer wieder bemüht wird (zu lange Wege zu Gottesdiensten, zu wenig Platz im alten Gebäude etc.): So, wie man Gebäude weihen konnte, waren sie ebenso leicht wieder zu entweihen. Sie konnten aufgegeben, umgenutzt oder direkt abgebrochen und ihr Material anderweitig wiederverwendet werden.
Das Aufspüren dieser abgegangenen Kapellen und damit zusammenhängend die Frage nach ihrem Bau und Verschwinden trägt zum Verständnis der früh- und hochmittelalterlichen Geschichte von Weinfelden bei. Wenn es um Kapellen, Kirchen und Klöster geht, ist im Mittelalter nichts dem Zufall überlassen. Weder die Wahl des Ortes noch diejenige des oder der Heiligen, dem oder der die Einrichtung gewidmet ist. Da darf man sich von Narrativen in Urkunden (fromme Herren, Stiftungen aus Dankbarkeit, aber auch Topoi wie weite Wege durch, Märsche der Gottesdienstbesucher durch schwieriges Gelände u. ä. bei der Gründung von eigenen Kirchen) nicht zu sehr täuschen lassen. Es geht auch um Realpolitik, um Herrschaft, herrschaftliche Rechte, Pfründen, Abhängigkeiten und Beziehungen, früh- und hochmittelalterliche Verfasstheit. Kapellen lassen auf grundherrschaftliche Begebenheiten rückschliessen! So sind solche (früh-)mittelalterlichen Kapellen bzw. die Hinweise auf sie interessante Indizien, von denen aus sich weiterdenken lässt. Wie ist Weinfelden als Dorf aus den mittelalterlichen Höfen, Grundherrschaften und Rechten unterschiedlichster Bezugssysteme und Herrschaftsverbänden entstanden, auf welcher Grundlage und wie fand die «Verdorfung» rechtlich und als Beziehungsgefüge im Spätmittelalter statt? An Erkenntnissen in dieser Richtung wird derzeit intensiv wissenschaftlich gearbeitet und zum ersten Mal dürfen wir für unsere Gegend eine moderne Darstellung zu diesen Fragen erwarten:
Ein Team der Thurgauer Denkmalpflege (Regine Abegg und Peter Erni) schreiben in der Reihe «Kunstdenkmäler der Schweiz» aktuell am Band «Weinfelden und seine südwestliche Umgebung». Darin werden nicht nur die neuesten Erkenntnisse zu Gebäuden und Baugeschichten, sondern auch eine wissenschaftliche Darstellung der Weinfelder Siedlungs- und Herrschaftsgeschichte erarbeitet.
Damit endet der Spaziergang im Kappelerweg und das Stirnrunzeln hat sich etwas entspannt. Und doch ist noch etwas hängen geblieben: Es hatte doch alles mit dem Namen begonnen, die merkwürdige Lautung und Betonung. Dass die Kapelle in den Reben am Kappelerweg tatsächlich aus dem frühen Mittelalter stammte, lässt sich nämlich indirekt sogar am Flurnamen bzw. dem Wegnamen ablesen:
Das heute geläufige Wort Kapelle wurde erst spätmittelalterlich aus den romanischen Sprachen entlehnt, dafür spricht die Betonung, da das ursprünglich lateinische Wort capélla lautet (Betonung auf dem «e», darum dann auch zwei «L»). Hingegen gab es aber schon eine Entlehnung desselben Wortes über das Fränkische im Frühmittelalter: Dort fand ein sogenannter Silbenumsprung (nun Erstbetonung und damit Verdoppelung des P-Lautes) statt und die althochdeutsche Lautverschiebung machte aus káppela noch ein Cháppela. Die Erstsilbenbetonung sorgte noch für eine Abschwächung der Endsilbe. – Schweizerdeutsch Chappel ist geläufig. Wie übrigens auch die Namensbildung mit diesem Wort, denken wir an Ebnat-Kappel, Kappel am Albis …
So erzählt dieser Weg, der eigentlich offiziell nie einen Namen hatte, erst seit dem Ende der 1940er-Jahre wieder eine Geschichte. Die ans Schriftdeutsche angenäherte Schreibweise auf der Strassentafel überdeckt so etwas, was mundartlich eigentlich möglich wäre, aber dadurch, dass man es schriftlich fixiert, in Vergessenheit gerät. Bei genauem Hinhören sagt wohl noch mancher «Chappelerweg». Man darf sich eben nicht von Strassenschildern trügen lassen.
Hinweise
Die Kunstdenkmäler der Schweiz KdS: Die bisher erschienen Werke zum Kanton Thurgau: https://www.gsk.ch/de/die-kunstdenkmaeler-der-schweiz-kds-tg.html. – Das Erscheinen des Bandes zu Weinfelden wird ungefähr auf 2025 veranschlagt.
Die Darstellung von Keller liefert den einzigen bisher bekannten direkten Hinweis auf die Kapelle im «Kappeler», der Zusammenhang zum Jahr 1436 aber ist rätselhaft. Er spricht in einem Atemzug im gleichen Abschnitt vom Verkauf der Weinfelder (und anderer) Herrschaftsrechte, auf welche die Herren von Bussnang zugunsten Berthold Vogts von Konstanz verzichten; diese Transaktionen geschahen aber bei genauem Hinsehen schon früher und ein Zusammenhang zur Kapelle und den bekannten Urkunden zu diesem «Geschäft» lässt sich aktuell nicht herstellen. Dafür ist die Urkunde zu pauschal formuliert. Dass mit der Kapelle alte Pfründe und Rechte verbunden waren, auf welche die Bussnanger hier verzichten, ist aber durchaus denkbar.
Zitierte Autoren
- Keller, Johann Adam: Chronik von Weinfelden. Weinfelden 1864, zweite Auflage 1931, S. 47.
- Lei, Hermann: Evangelisch Weinfelden – Ein Blick zurück. Weinfelden 1979, S. 7.
Beitragsbild: Eingang Kappelerweg (Seite Burg) im Quartier Gontershofen. – Bild: M. Mente.

Michael Mente – ist Historiker, Archivar, Autor verschiedener Bücher und Beiträge und arbeitet derzeit in der Denkmalpflege des Kantons Thurgau. Er ist in Weinfelden aufgewachsen und schreibt für den Wyfelder seit Start. In der Reihe «Fundstücke aus der Weinfelder Geschichte und Kultur» erzählt er uns zudem in loser Reihenfolge durch «sein» Weinfelden spazierend von unserem Städtchen.