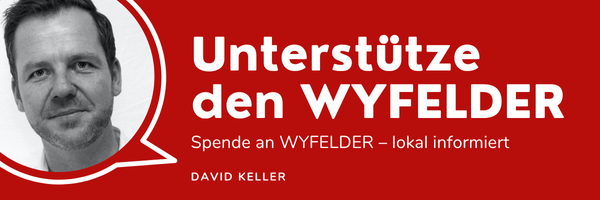Seit jenem Abend im Treppenhaus ist einige Zeit vergangen, und doch habe ich das Gefühl, dass genau dort etwas ins Rollen gekommen ist. Es war kein Paukenschlag, keine grosse Einsicht, eher ein leiser innerer Entscheid: Ich möchte die Menschen um mich herum nicht mehr nur «mitlaufen» sehen, sondern wahrnehmen. Und ich durfte in den vergangenen Tagen erfahren, wie schnell aus einer einfachen Höflichkeit etwas Tieferes entstehen kann, wenn man bereit ist, dranzubleiben.
Ein paar Tage nach unserem Treppenhaus-Moment kam ich erneut spät nach Hause. Wieder lag der Tag schwer in den Schultern, wieder war der Kopf voller unerledigter Aufgaben. Als ich die Wohnungstür aufschliessen wollte, sah ich auf dem Boden einen kleinen Zettel. Sorgfältig mit der Hand geschrieben, stand darauf: «Danke für Ihre Hilfe neulich. Es hat mir gutgetan, gesehen zu werden.» Daneben lag ein kleines Säckchen mit selbst gebackenen Guetzli – Sterne, nicht perfekt, aber mit sichtbarer Sorgfalt. Es war eine überraschend schlichte Geste, und gerade darum berührte sie mich so stark. Da hatte jemand nicht nur «Danke» gesagt, sondern auch gezeigt: Dieser Moment war wichtig. Ich begann, meine Nachbarin öfter anzusprechen, wenn wir uns im Treppenhaus begegneten. Am Anfang waren es ein paar Worte über die Kälte, den Nebel, den vollen Bus. Doch Schritt für Schritt öffnete sich ein Raum, in dem man sich etwas mehr erzählen konnte. Nicht alle Geheimnisse, nicht das tiefste Innere – aber genug, um zu spüren: Hier wohnt ein Mensch mit Sorgen, Hoffnungen, Erinnerungen. Einer, der sich ebenfalls fragt, wie er gut durch den Alltag kommt. Es war, als hätte jemand das Licht in einem Flur eingeschaltet, der vorher nur im Halbdunkel lag.
Mit dieser neuen Aufmerksamkeit veränderte sich auch mein Blick auf andere Begegnungen. Die Frau, die jeden Morgen früh die Zeitungen austrägt, bekam plötzlich ein bewusstes «Guten Morgen, und danke für Ihren Einsatz». Ihr Lächeln war zunächst zögerlich, beim dritten Tag aber schon beinahe vertraut. Der ältere Herr, den ich oft mit seinem Rollator Richtung Zentrum sah, wurde nicht länger nur ein Teil des Strassenbilds. Ich blieb einmal stehen, begrüsste ihn, fragte nach seiner Runde. Er erzählte, dass er früher Lehrer gewesen sei und jetzt manchmal staune, wie still es um ihn geworden sei. «Man gewöhnt sich daran», sagte er, «aber manchmal fehlt es trotzdem, dass jemand einfach zuhört.»
Mir wurde klar: Weinfelden ist voll von solchen Geschichten. Manche sind laut, andere laufen leise im Hintergrund. Viele Menschen würden vielleicht gar nicht viel verlangen – nur einen Moment von echtem Interesse. Wir sind es jedoch so sehr gewohnt, in unserem eigenen Tunnel unterwegs zu sein, dass wir diese Chancen vorbeiziehen lassen wie den Zug, den wir nicht erwischen mussten. Dabei ist es gerade in einer überschaubaren Stadt wie unserer möglich, dass sich etwas verändert, wenn einige wenige beginnen, anders hinzusehen. Ich nahm mir deshalb bewusst vor, jede Adventswoche einer Person zu schenken, die mir sonst nur am Rand aufgefallen wäre. Das klingt vielleicht pathetisch, meinte aber nichts anderes als: einmal mehr zuhören, einmal länger stehenbleiben, einmal nicht so tun, als hätte man keine Zeit. Und jedes Mal entstand etwas, das sich lohnte. Manchmal war es nur ein kurzes Gespräch, das beide zum Lächeln brachte. Manchmal ein Satz, der hängen blieb. Manchmal das Gefühl, dass der andere sich aufrecht hinsetzt, weil er merkt: «Da ist jemand, der nimmt mich wahr.»
Vielleicht kennst du diese inneren Einwände: «Ich will niemandem auf die Nerven gehen», «Ich bin selber müde», «Was, wenn der andere gar nicht reden will?» Diese Gedanken sind verständlich. Aber meine Erfahrung in den vergangenen Tagen war, dass man viel öfter willkommen ist, als man denkt – solange man respektvoll bleibt. Niemand verlangt, dass wir zu Seelsorgern unserer Nachbarschaft werden. Aber wir können entscheiden, ob wir weiterlaufen, wenn jemand offensichtlich schwer trägt, oder ob wir zumindest fragen: «Geht es?» Oft ist mehr möglich, als wir uns zutrauen.Der zweite Adventssonntag bringt uns der eigentlichen Weihnachtszeit ein Stück näher. Gleichzeitig steigt die Hektik: Geschenke, Termine, Jahresabschlüsse, Erwartungen. Gerade jetzt haben wir das Gefühl, keine Minute verschenken zu können. Vielleicht wäre es aber genau jetzt wichtig, eine Minute zu «verschenken» – an jemanden, der sie dringender benötigt als wir. Ein Gespräch im Coop, ein kurzes «Komm, ich helfe dir», ein warmes Wort an jemanden, der sonst nur sachlich angesprochen wird.
So hat sich mein Umfeld langsam verändert. Nicht spektakulär, nicht dramatisch – aber spürbar. Ich fühle mich weniger als ein Gast in meinem eigenen Haus, in meiner Strasse, in meiner Stadt. Ich habe das Gefühl, Teil von etwas zu sein, das man «Nachbarschaft» nennen könnte, ohne es künstlich aufzublasen. Und alles begann mit einer Einkaufstasche und einem Satz auf einem Zettel.
Nächsten Sonntag erzähle ich, wie aus mehreren solchen Momenten überraschend eine kleine Gemeinschaft entstanden ist – und weshalb Nachbarschaft mehr werden kann als das zufällige Teilen derselben Postleitzahl.
Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern eine frohe und besinnliche Weihnachtszeit.
Leserbeitrag – anonym