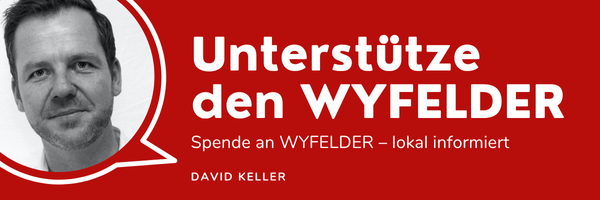Seit einem Jahr ist das nationale Veloweggesetz (VWG) in Kraft und bedeutet einen Meilenstein für die Förderung der Velomobilität in der Schweiz. Wie weit sind die Kantone Appenzell Ausserrhoden, St.Gallen und Thurgau in der Umsetzung ihrer Velowegnetzplanungen? Welche Aufgaben kommen auf die Gemeinden zu? Und braucht es eine regionale Koordination? Diesen und weiteren Fragen widmete sich vergangenem Montag das Forum «Zukunft Velo – von Paragrafen und Pedalen», zu welchem die REGIO Appenzell AR-St.Gallen-Bodensee Vertreterinnen und Vertreter aus Gemeinden, den kantonalen Verwaltungen, Sportorganisationen und weitere Fachpersonen einlud.
Ob zur Arbeit, in der Freizeit oder als sportliche Betätigung: Velofahren auf den Strassen und im Gelände boomt. Wenig überraschend zählt das Velo zu den beliebtesten Sportarten in der Schweiz: 49.9 Prozent der Schweizer Bevölkerung fahren Velo (inkl. Mountainbiken)[1]. «Seit dem 1. Januar 2023 ist das neue Veloweggesetz (VWG) in Kraft und bedeutet einen Meilenstein für die Veloförderung in der Schweiz. Ein Jahr ist seither vergangen, wo steht unsere Region in der Planung?» mit diesen Worten leitete Michael Götte, Präsident REGIO, das Forum ein und begrüsste im Pavillon Sportfeld Gründenmoos die über 60 Teilnehmenden.
Velo-Alltags- und Freizeitnetz: Bund, Kantone und Gemeinden in der Pflicht
Marco Starkermann, Projektleiter Verkehrsplanung bei Metron, begleitet mehrere Ostschweizer Kantone und Gemeinden bei der Umsetzung der neuen Vorgaben des VWG. Im ersten Teil des Forums gab er einen vertieften Einblick in die Grundlagen des Veloweggesetzes, welches die Kantone verpflichtet, in den nächsten vier Jahren auf ihren Strassen ein Velowegnetz zu planen und bis 2042 umzusetzen. Das VWG enthält im Sinne von übergeordneten Planungsgrundsätzen zudem fünf Qualitätsziele (zusammenhängend, direkt, sicher, homogen, attraktiv), die dafür sorgen, dass Velofahren sicherer und einfacher wird. Ergänzend zum Alltagsnetz müssen die Kantone neu auch ein Netz für die Freizeit planen und realisieren. Die unterschiedlichen Grundsätze «Der Weg zum Ziel» versus «Der Weg als Ziel» verdeutlichen dabei auf eingängliche Art, welche unterschiedlichen Voraussetzungen an die beiden Netztypen gestellt werden. «Während es im Alltagsnetz in erster Linie darum geht ein möglichst direktes und sicher befahrbares Netz in und zwischen Siedlungsgebieten für alle zwischen 8 und 80 Jahren zu gewährleisten, liegen Freizeitnetze ausserhalb des Siedlungsgebietes. Statt der direkten Linienführung steht hier eine hohe Erholungsqualität und eine attraktive Erschliessung von Landschaften, Freizeitanlagen und touristischen Einrichtungen im Vordergrund», erläuterte Starkermann.
Im Realitätscheck mit den Kantonsvertretern Daniel Litscher (Leiter Fachstelle Fuss- und Veloverkehr Kt. SG), Ueli Schmid (Projektleiter Strassenbau, Tiefbauamt Kt. AR) und Toni Scheuchzer (Projektleiter Fachstelle Langsamverkehr Kt. TG) – wurde klar, dass die Kantone sich zwar in ihrer zeitlichen Planung und ihren Herangehensweisen unterscheiden, jedoch auch viele gemeinsame Nenner vorhanden sind. Dazu zählt insbesondere die Abstimmung der Planung der Alltagsnetze über das Agglomerationsprogramm St.Gallen-Bodensee; ebenso wichtig ist es, die Gemeinden einzubeziehen und basierend auf Schwachstellen- und Potenzialanalysen Prioritäten dort zu setzen, wo die wirkungsvollsten Verbesserungen realisiert werden können.
Vom Informieren zum Diskutieren und Involvieren
Im zweiten Teil des Forums konnten sich die Teilnehmenden an vier Workshops mit konkreten Themen auseinandersetzen:
Workshop 1: Mountainbike: Aktuelle Rahmenbedingungen und wie gestalten die Gemeinden ein offizielles Wegnetz?
Mountainbiken ist beliebt und hat sich auch in der Ostschweiz zu einem Breitensport entwickelt. Angesichts des stetigen Wachstums und der steigenden Erwartungen an Infrastrukturen steigt der Druck auf den öffentlichen Wegnetzen. Im Workshop wurden die aktuellen Rahmenbedingungen für das Mountainbiken sowie das konkrete Vorgehen der Gemeinden zu einem offiziellen Wegnetz diskutiert. Workshop-Verantwortliche: Roger Walser und Adrian Stäuble (BikerNetzwerk AG) und Dave Spielmann (SchweizMobil)
Workshop 2: Das Veloland-Netz von SchweizMobil und wie soll die Planung in den Kantonen erfolgen?
Ergänzend zum Alltagsnetz müssen die Kantone neu auch ein Freizeitnetz planen und umsetzen. Diese Planung geht vom etablierten Veloland-Netz von SchweizMobil aus. Gemeinsam mit den Kantonen überprüft SchweizMobil das bestehende Netz und die Routen und passt diese entsprechend an. Am Forum wurde mit den Teilnehmenden diskutiert, wo die Ostschweizer Kantone in diesem Prozess stehen, welche Rolle die Gemeinden (und allenfalls Regionen) in der Planung und Umsetzung des Netzes Velofreizeit spielen und welche Bedürfnisse und Anliegen zur bestehenden Infrastruktur existieren.
Workshop-Verantwortlicher: Michael Bur (SchweizMobil)
Workshop 3: Wie können Gemeinden ihr Alltagsnetz planen und umsetzen?
Dieser Workshop bot die Gelegenheit, mehr über die Planung des Alltagsnetzes in Gemeinden zu erfahren und sich über verfügbare Projektierungshilfen auszutauschen. Der Fokus wurde auf das Alltagsnetz in der Agglomeration St.Gallen-Bodensee gelegt und wie man Gemeinden und der Bevölkerung die Relevanz des Themas aufzeigen kann. Auch stand die Frage im Raum, wie Nicht-AGGLO-Gemeinden bei der Netzplanung vorgehen können und warum eine fundierte Schwachstellenanalyse im Fuss- und Veloverkehr mit Blick auf Unterhalts- und Finanzplanung auch für ländliche Gemeinden zielführend sein kann.
Workshop-Verantwortliche: Tobias Winiger (AGGLO St.Gallen-Bodensee) und Marco Starkermann (Metron)
Workshop 4: Radentwicklung Ostschweiz: Wie kann die Bekanntheit der Ostschweiz als attraktive Rennrad- und Gravel-Region gesteigert werden?
Die Tourismusbranche sowie Vertreterinnen und Vertreter von Stadt und Kanton St.Gallen sind sich einig: Das Thema Velofahren besitzt sowohl aus touristischer als auch aus gesundheitsfördernder Perspektive eine hohe Relevanz. Im Rahmen des Projekts «Radentwicklung Ostschweiz – Cycling» setzt sich St.Gallen-Bodensee Tourismus zum Ziel, das Veloangebot zu präsentieren und buch- sowie sichtbar zu machen und die bisher noch wenig erschlossene Zielgruppe der Radrennfahrerinnen und Radrennfahrer und Gravelfahrerinnen und Gravelfahrer anzusprechen. Auf die Sommersaison hin werden bereits erste buchbare Angebote am Markt getestet. Gemeinsam mit den Teilnehmenden wurden Ansatzpunkte für die Entwicklung dieser Angebote sowie der Umgang mit möglichen Stolpersteinen diskutiert.
Workshop-Verantwortliche: Patricia Fritschi (Unternehmensberaterin) und Janine Würth (St.Gallen-Bodensee Tourismus)
Fazit Forum
In den Workshops kristallisierte sich heraus, dass Gesprächsbedarf für vielseitige Anliegen besteht und die heutige Dialogmöglichkeit geschätzt wurde. Sei es bei der Entwicklung von neuen touristischen Angeboten im Bereich Rennrad- und Gravelfahren, bei der Entwicklung von Mountainbikerouten oder der Verbesserung des Freizeit- und Alltagsnetzes im Allgemeinen: Die vielfältigen Bedürfnisse und Erwartungen unter einen Hut zu bringen, bleibt eine grosse Herausforderung und erfordert den Einbezug zahlreicher Anspruchsgruppen.
Dass es im neuen VWG neben einem im Aggloprogramm abgebildeten Alltagsnetz auch um Freizeitnetze geht, war für viele Gemeinden neu. Thomas Schnyder, Gemeindepräsident Hefenhofen, nimmt als Erkenntnis mit, dass der Freizeitbereich in den Gemeinden bisher kaum ein Thema war: «Der Fokus lag auf dem Alltagsnetz. Durch das neue Gesetz wird sich dies ändern. Nur schon, dass es das VWG gibt, hilft, dass wir uns aktiv mit dem Freizeitnetz auseinandersetzen.»
Auf die Frage, wann die Umsetzung des Veloweggesetz geglückt sei, sprach Patricia Fritschi wohl für alle Anwesenden, als sie sagte: «Wenn wir Begeisterung auslösen können fürs Velo, haben wir schon sehr viel erreicht.»
Damit diese Begeisterung entstehen kann, braucht es zentrale Verbesserungen und den Mut für pragmatische Lösungen: «Im Zweifelsfall ist eine nicht perfekte Lösung besser, als keine Massnahme. Wenn in Zukunft auch die Leute Velo fahren, die sich heute aus Sicherheitsgründen nicht wagen, dann haben wir ein grosses Ziel erreicht», sagte Tobias Winiger, Leiter AGGLO St.Gallen-Bodensee.
In der Schlussrunde hat sich klar gezeigt, ein Velowegnetz zu planen – ob für die Freizeit oder den Alltag – kann nicht ohne den Blick über die Grenzen geschehen. «Wir brauchen eine regionale Koordination; wie wir dies bereits für das Velo-Alltagsnetz über das Agglomerationsprogramm kennen, wäre dies auch für den Freizeitbereich wünschenswert. Diesem Thema werden wir uns in den nächsten Wochen widmen und schauen, wie Synergien und Ressourcen zielgerichtet und effizient eingesetzt werden können», bilanziert Leila Hauri, Moderatorin des Forums und Geschäftsleiterin REGIO Appenzell AR-St.Gallen-Bodensee, das Forum.
[1] Sport Schweiz 2020: Factsheet Sportarten, S. 52, https://www.sportobs.ch/inhalte/Downloads/Sport_Schweiz_2020_factsheets_d_screen.pdf.pdf
Zur Projektseite mit weiteren Impressionen
Quelle: REGIO Appenzell AR-St.Gallen-Bodensee
Foto: REGIO Appenzell AR-St.Gallen-Bodensee