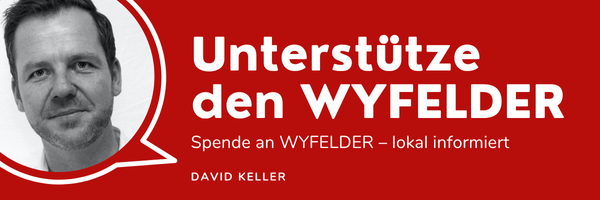moMente eines Stadtschreibenden #4
Michael Mente
Ich sitze viel im Zug. Immer wieder ergeben sich spannende und fruchtbare Begegnungen. Ich würde gerne einmal dem Zürcher Reformator Ulrich Zwingli (1484–1531) gegenübersitzen. Unter anderem würde ich mich mit ihm auch über die Eisenbahn unterhalten. Ich bin überzeugt, er hätte ein GA und würde gerne Bahn fahren. Vermutlich deshalb, weil er erkannt hat, dass die Schweizer Eisenbahnen seinen Ideen mehr Vorschub geleistet haben, als man sich dessen bewusst ist. Die Reformation und ihre Folgen hat die Schweiz genauso auf ihre Weise zu dem gemacht, was sie heute ist, wie die Eisenbahn seit dem 19. Jahrhundert. Welche Parallelen fände er wohl?
Der reformierte Kopfbahnhof
Ich habe Zwingli erzählt, dass wir Reformationsjubiläum gefeiert haben und ihm erklärt, unter welchen Vorzeichen dies zum 500. Mal geschah. Zwar hat er eingeworfen, was er schon einmal gesagt hat: «Vor dem Herrn bezeuge ich: Wenn dann meine Schriften einmal von allen gelesen wären, so wünschte ich, mein Name geriete allenthalten wieder in Vergessenheit». Das hat aus verschiedenen Gründen nicht geklappt. Und als ich ihm erklärt habe, was in den letzten Jahrhunderten geschehen war, wurde er stiller. Ganz ohne Köpfe geht es eben auch bei den Reformierten nicht, aber es braucht trotzdem das kritische Köpfchen des selber denkenden Protestanten (hier nicht: Protestierenden), das zu durchschauen versucht, was Geschichtsschreibung und Meinung ist und was Geschichte (und deren Übersetzung ins Hier und Heute) sein könnte. Mir kam in den Sinn, dass es auch symbolisch eine interessante Fügung war, das Zürcher Jubiläum im Januar 2017 im Zürcher Hauptbahnhof gestartet wurde. Von hier aus begannen viele Aufbrüche. Und nach Zwingli folgten nicht nur weitere Reformatoren, die eine Bewegung festigten, die von Zürich aus in die ganze Welt vorstiess; auch die Eisenbahn, die in Zürich 1847, vor über 160 Jahren, erstmals losgefahren ist, sollte reformatorisch geprägtem Gedankengut 300 Jahre später noch einmal ganz gehörig Vorschub leisten. Wer sagt denn, dass ein Kopf-Bahnhof ein Endbahnhof ist! (Auch das wurde im HB mit den unterirdischen Bahnhofsteilen längst überwunden).
Die Reformatoren des 19. Jahrhunderts
Wie ich darauf komme? – Einer der grossen – reformierten – «Eisenbahn-Barone», Adolf Guyer-Zeller, hält 1871 eine Rede mit einem Satz, der aufhorchen lässt: «Die Eisenbahnen sind die Reformatoren des 19. Jahrhunderts. Sie haben die Menschen einander viel näher gebracht als die Weisen. Die technischen Errungenschaften können uns nicht mehr entrissen werden, während die sog. geistigen Wahrheiten nur so lange wahr bleiben, bis wieder ein Anderer kommt u. das Gegentheil lehrt.»[1]
Klar, in diesem Votum von vor 140 Jahren schimmert eine Technologie- und Fortschrittsgläubigkeit durch, die ebenso an das 19. Jahrhundert gebunden ist wie die Zwingli-Statue. Und lassen wir mal beiseite, dass Guyer-Zellers Reformation eine unverkennbar säkulare Angelegenheit ist. Spannend ist doch, dass sich im frühen Eisenbahnbau Investoren, Unternehmer und Politiker – denken wir an die Namen Alfred Escher oder eben Guyer-Zeller – engagiert haben, deren liberale Gesinnung in reformiert geprägten Städten entsprungen ist. Der Gedanke, dass Eisenbahnen Reformatoren sind, besticht!
Eben hatte die Schweiz, vor etwas über 160 Jahren, mit dem «Sonderbundskrieg» den letzten Bürgerkrieg erlebt. Das Streben nach Konsens und Ausgleich, ein prägendes Element der föderalen Willensnation Schweiz, war nun wichtiger denn je. Der folgende Eisenbahnbau war nicht nur Ausdruck dieser Haltung, sondern gleichzeitig ihre Förderung: Die Verbreitung von Ideen und Haltungen kam dank der Eisenbahn schneller voran als in Reden.[2] War der Bahnbau zwar bis zur Jahrhundertwende Privatsache – Zwingli hört Eigennutz – verschiedener Investoren, war die Folge doch im Sinne Zwinglis. Ein Gemeinnutz bestand etwa in der Beförderung der von der Reformation geforderten Gleichwertigkeit der Menschen.
Demokratie auf Rädern
Die Bahnbauer haben das Postulat der Reformatoren für die Gleichwertigkeit sogar mit dem Rollmaterial unterstützt. Es ist eine Schweizer Eigenheit (die man mit der «Schwesterrepublik» jenseits des Atlantiks gemeinsam hat), dass sich die ersten Eisenbahnen für den sogenannten Durchgangswagen entschieden haben. In den umliegenden Monarchien entschieden sich die Eisenbahngesellschaften für den Einsatz von Waggons mit Coupés, also Abteile mit eigener seitlicher Türe. Hierzulande kam der Durchgangswagen mit Mittelgang zum Einsatz: Freie Zirkulation wurde ermöglicht, ein politisches Bekenntnis auf Rädern sozusagen. Diese Art Wagen galt als demokratisch. In Abteilwagen bleiben die Klassen tendenziell unter sich (und eher unter Kontrolle?).[3]
In der Tat dürfte dieses System zur Durchmischung der gesellschaftlichen Klassen mehr beigetragen als schöne Reden nie ganz uneigennütziger Politiker. Zwingli hätte seine Freude daran gehabt, in den damaligen Schweizer Zügen Kondukteur zu sein. Die heutigen Vierer-Abteile, daran hält die Schweiz in der Regel fest, sind auch nicht ohne – wenn man denn reden will.
Klar, Bahngeschichte ist komplexer und hat viele Aspekte. Mit der ersten Eisenbahn und dem Sonderbundskrieg 1847 kamen auch die ersten Militärtransporte und die meisten Bauarbeiter dürften katholisch gewesen sein. Paradebeispiel ist der Gotthardtunnel des (reformierten) Genfers Favre. Was für die Ideen der Reformation gilt, trifft auch für die Schweizer Bahn zu: Der Same ist gesetzt. Die von der Reformation postulierte Gleichwertigkeit der Menschen wurde zwar zu einem guten Stück aufgegleist und befördert, aber noch lange und bis heute nicht im gewünschten Mass realisiert. Und: Gab es zwar von Anfang an Klassen, so sind diese – zumindest theoretisch – jedem zugänglich.
Die Reisenden, egal welcher Klasse, werden in die gleiche Richtung befördert. Mal kommen die einen, mal die anderen schneller ans Ziel, je nach Zugsformation und Fahrtrichtung. Was bleibt ist die freie Zirkulation. Wie auch die freie Zirkulation von Ideen und Meinungen in einer demokratischen und liberalen Schweiz, die dank der Eisenbahn und Impulsen seit der Reformation zu dem geworden ist, was sie heute ist.
Und die Söldnerzüge…
Man sieht: Das Gespräch mit Zwingli wäre anregend; die Metapher der Reise und der Eisenbahn lässt sich ja ohnehin für so vieles auf unser Leben und unsere Umwelt übertragen. Spontan kommt mir das «Beresina-Lied» in den Sinn: «Unser Leben gleicht der Reise eines Wandrers in der Nacht. Jeder hat in seinem Gleise, etwas, das ihm Kummer macht.»
Mit dieser Strophe beginnt das berühmte Lied, das seit 1812 fast zur zweiten Nationalhymne und zum Symbol für die Aufopferung von Schweizer Söldnern in fremden Kriegsdiensten geworden ist. Dass in diesem Lied bereits ein «Gleis» erwähnt wird, wo die Eisenbahn noch in weiter Ferne ist, ist nebenbei eine kleine Steilvorlage zum Gespräch. Zwingli hat ja so Manches Kummer bereitet – unter anderem just dieses Söldnerwesen, gegen das er angetreten ist und im Volk viel Kummer verursacht hat. Höchste Eisenbahn für einschneidende Reformen!
Wohin geht die Reise?
Klar, vor 500 Jahren wurden mit der Reformation zweifellos viele Weichen gestellt. Es ist aber etwas wie der Blick am Ende der Gleishalle des Zürcher Hauptbahnhofes auf das offene Gleisfeld: ein Gewirr von Weichen, über das sich die Züge schlängeln. Ein Laie sieht kaum auf den ersten Blick, wohin die sogenannte Fahrstrasse etwa für einen ausfahrenden Zug über die sich kreuzenden Schienen gestellt ist – und wo das entschieden wird. Man darf vertrauen.
7. November 2021. Es ist Reformationssonntag. – Reformationssonntag? Er erscheint jeweils am ersten Kalendersonntag im November, in diskretem Abstand zum 31. Oktober. Halloween? Bei allen guten Geistern, nein: ReformationsTAG. An diesem Datum schlug Martin Luther nach ungesicherter Überlieferung 1517 seine Thesen an die Schlosstür zu Wittenberg, die Geburtsstunde der Reformation. Darauf bezieht er sich – und übrigens auch nicht auf den Weltspartag; den Gedankengang zu Calvin ersparen wir uns hier. Auf alle Fälle verweist er auf Eigenständigkeit: Die Schweiz feiert mit der Welt die Reformation, versammelt aber auch die eigenen Reformatoren und Traditionen, die auf die Welt wirkten. Es gibt mittlerweile eine Fülle von Tag des XY-Terminen, amüsante, ernsthafte, alberne. Fragen Sie mich nicht, wer solches festlegt und wie es sich dann auch durchsetzt. Doch seien wir ehrlich: Kaum jemand scheint den 1896 schweizweit, Kantönli- und andere Abgrenzungsgeister überwindende Reformationstag ausserhalb der engeren und engsten Kirchenkreise noch zu kennen.
Mein Kopf ist so gut wie jeder andere, es war ja auch nicht nur ein Kopf, der den Reformations-Zug in Gang gesetzt hatte. In der evangelischen Kirche von Weinfelden sind beide Portraits in den Seitengängen aufgemalt: Luther und Zwingli. Genauso gut könnte man am Reformationstag, dem 31. Oktober, der heute von Halloween überschattet und kaum mehr als der internationale Gedenktag der Reformation bekannt ist, auch einmal im deutschen ICE mit Martin Luther zum Gespräch durchs Land brausen.
Es stellt sich also nicht die Frage, welche Reformation Vorfahrt hat und ob die Schweizer nur eine Abzweigung der Deutschen wäre. – In den Lehren und Absichten der beiden Reformatoren gab es zwar Unterschiede und Unvereinbarkeiten, aber auch Gemeinsamkeiten. Das gilt auch für die Eisenbahn: Beide Haupt-Bahnsysteme in Deutschland und der Schweiz fahren auf 1435 mm Spur, sind mit der gleichen Spannung von 15 kV sowie der gleichen Stromfrequenz 16 2/3 Hz versehen. Verschiedene Fahrzeuge, Sicherungssysteme und Vorschriften sind darauf ausgelegt, dass grenzüberschreitend – höre, verbindend, aber dafür braucht es Absprachen und Koordination auf Augenhöhe – gefahren werden kann.
Nun, langer Rede grosser Züge: Gemeinsamkeiten und doch Unterschiede. Seit 1973 sind die letzten Dispute mit der sogenannten Leuenberger Konkordie überwunden und man kann gemeinsam im Speisewagen des Lebens Abendmahl halten und Fahrgemeinschaften bilden.
Zwingli wusste nicht, wohin die Reise geht; er wollte vor allem eines: einen Zug in Bewegung setzen. Auch damals hörte er auf die unterschiedlichen Bedürfnisse und setzte auf verschiedene Geschwindigkeiten und Stationen. In Schweizer Zügen kann man nebenbei auch rückwärts vorwärtsfahren. Unterdessen haben wir kaum mehr Lokomotiven, der Antrieb eines Zuges ist auf die ganze Komposition verteilt (unter allen Klassen sind Motoren). Die gemeinsame Blickrichtung auf ein (fernes) Ziel der Reisenden hat durchaus theologische Grund-Züge. Die Reformation soll weiterfahren. Einige Züge haben dabei ihr Ziel erst mit der Geschichte, nach einigen Zwischenhalten mit neuen Ideen oder in Kreuzung mit anderen Bewegungen erreicht. Einige sind unterdessen stillgelegt, einige rollen noch immer. Das Generalabonnement ist im Kopf eines jeden Mitreisenden.
Der Schweizer Reformationssonntag erinnert daran, dass uns das Evangelium zum selber Denken einlädt. Und mehr als das: Der Tag ist nicht nur ein Gedenken im Sinne eines Gedenk- und Mahnmals, ein Kind der Zeit, sondern ein Zug, den jeder besteigen darf: Der Tag erinnert an die Vergegenwärtigung. Die Schrift spricht jeden ganz persönlich an. Was holen wir aus dem Gespräch mit der Bibel ins Hier und Jetzt, für uns ganz persönlich, aber auch für die Gemein- und Gesellschaft, gerade in der heutigen Zeit? Das Evangelium, die Botschaft zur Befreiung. «Unser Leben gleicht der Reise eines Wandrers in der Nacht. Jeder hat in seinem Gleise, etwas, das ihm Kummer macht.»
(Überarbeitete Fassung eines am 10. Oktober 2017 erschienenen Beitrags auf «diesseits», dem damaligen Blog der Zürcher Landeskirche, wo der Verfasser regelmässig in seiner Eigenschaft als Beauftragter für das Reformationsjubiläum Artikel zum Thema veröffentlichte).
[1] Adolf Guyer-Zeller in einer Rede vom 29.5.1871; zitiert bei Wolfang Wahl-Guyer: «Die Eisenbahnen sind die Reformatoren des 19. Jahrhunderts»: Adolf Guyer-Zeller und die Töss-Allmann-Bahn, in: Heimatspiegel. Illustrierte Beilage im Verlag von Zürcher Oberländer und Anzeiger von Uster, Januar 2014, S. 3.
[2] Bis der erste katholisch-konservative Bundesrat gewählt worden war, sollte es aber noch etwas dauern. Im Jubiläumsjahr 1891 kam Josef Tremp ins Kollegium und just in seine Amtszeit fällt die Verstaatlichung der Schweizer Eisenbahn.
[3] Basierend auf den Überlegungen von Hans Peter Treichler in seinem Bericht über Familie Streuli im 19. Jh.

Michael Mente – ist Historiker, Archivar, Autor verschiedener Bücher und Beiträge und arbeitet derzeit in der Denkmalpflege des Kantons Thurgau. Er ist in Weinfelden aufgewachsen und schreibt für den Wyfelder seit Start. In der Reihe «Fundstücke aus der Weinfelder Geschichte und Kultur» erzählt er uns zudem in loser Reihenfolge durch «sein» Weinfelden spazierend von unserem Städtchen und teilt Gedanken in der Stadtschreiber-Kolumne «moMente».
Beitragsbild: pixabay